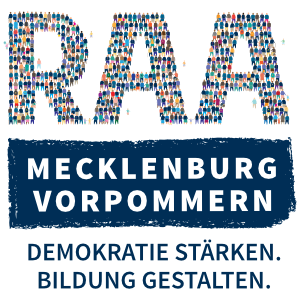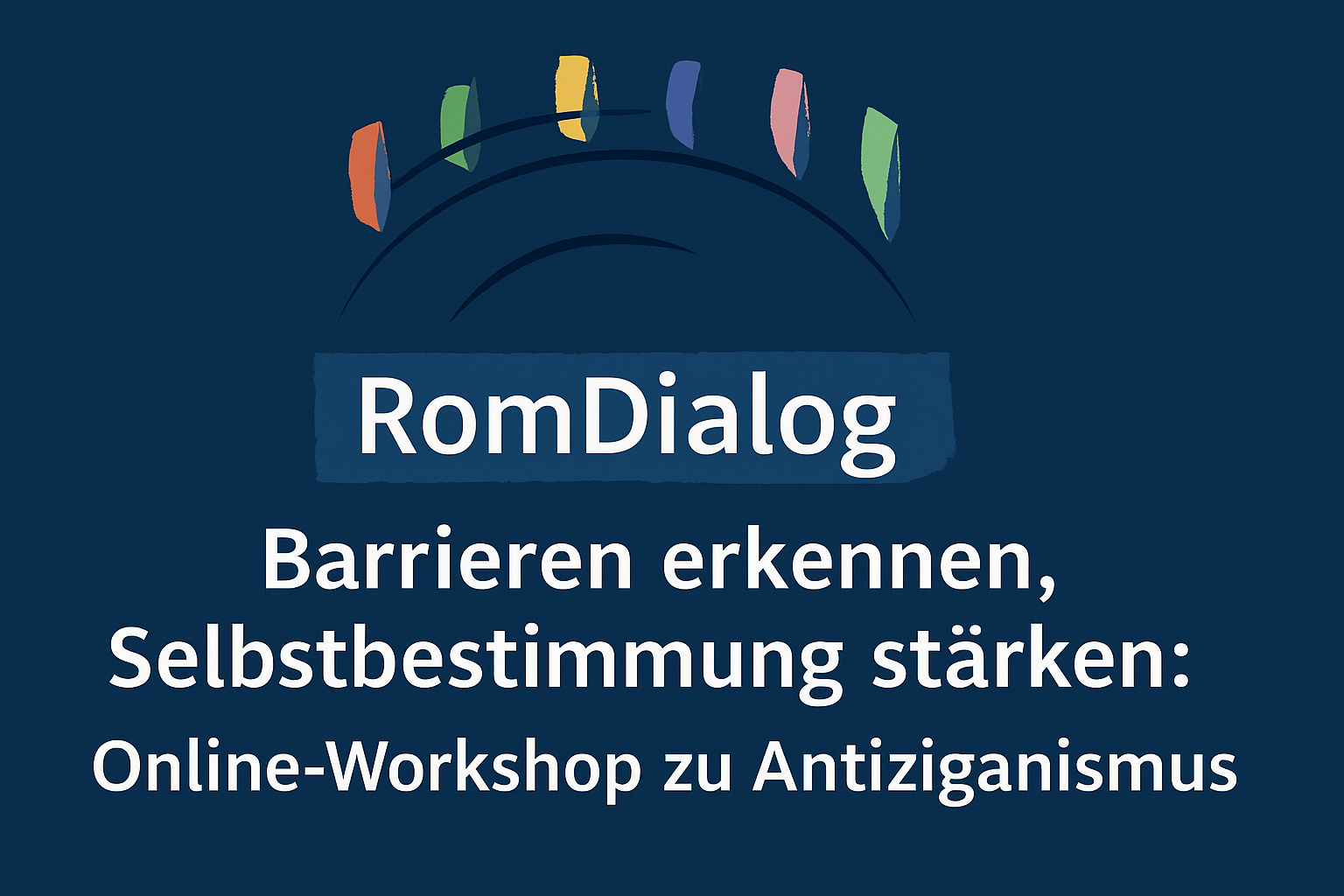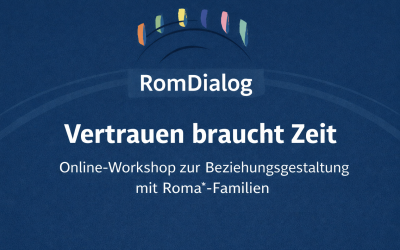Am 18. November 2025 veranstaltete das RAA-Projekt RomDialog einen Online-Workshop zur Sensibilisierung im Umgang mit vulnerablen Gruppen, mit besonderem Fokus auf Antiziganismus. Fachkräfte aus der sozialen Arbeit, der Migrations- und Integrationsberatung, der Jugendhilfe sowie aus kirchlich-diakonischen Arbeitsfeldern kamen zusammen, um sich über Erfahrungen und gute Praxis auszutauschen.
Einblicke aus Berry Paskowskis Bildungsarbeit
Den inhaltlichen Schwerpunkt gestaltete Berry Paskowski, Bildungsberater beim Landesverband der Sinti und Roma Schleswig-Holstein. Seit mehr als sieben Jahren arbeitet er an Schulen, begleitet täglich zahlreiche Kinder und vermittelt zwischen Eltern, Lehrkräften und Schüler:innen. In seinen Einblicken wurde deutlich, wie wichtig es ist, komplexe schulische Abläufe verständlich zu machen, kommunikative Ebenen zu vermitteln und Vertrauen aufzubauen. Zentrale Prinzipien seiner Arbeit sind Kommunikation auf Augenhöhe, das Kontexualisieren von Anforderungen und die Stärkung von Selbstwirksamkeit bei Kindern und Eltern. Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit ist zudem, positive Vorbilder sichtbar zu machen, etwa über Kinderliteratur zu Rukeli Trollmann oder weitere Beispiele erfolgreicher Sinti- und Roma-Sportler:innen. Solche Geschichten schaffen Identifikationsräume und ermöglichen Kindern, sich jenseits von problemorientierten Zuschreibungen wahrzunehmen.
Herausforderungen erkennen und professionell reagieren
Im Austausch wurde deutlich, dass viele Schwierigkeiten, die Fachkräfte im Alltag beobachten, vor allem soziale und strukturelle Ursachen haben. Fehlendes Wissen über das deutsche Bildungs- und Behördensystem, sprachliche Hürden, unsichere Aufenthaltslagen, belastende Lebenssituationen und Erfahrungen von Diskriminierung bestimmen die Handlungsspielräume vieler Familien wesentlich stärker als andere Einflüsse. Entscheidend sind daher die gesellschaftlichen Bedingungen und die institutionellen Barrieren, auf die die Familien treffen.
Besonders eindrücklich war ein Fall, den Berry Paskowski im Workshop ansprach: Ein elfjähriger Junge aus einer Sinti-Familie wurde von der Polizei aus dem Klassenzimmer im Rahmen einer Kontrolle in Handschellen abgeführt, ohne Zustimmung der Eltern und ohne sie vorab zu informieren. Der Verband Deutscher Sinti und Roma dokumentierte den Vorfall ausführlich und kritisierte das unverhältnismäßige Vorgehen der Einsatzkräfte. Solche Erfahrungen erschüttern Vertrauen tief und prägen das Verhältnis zu Behörden und Institutionen oft über Jahre hinweg.
Auch die Situation geflüchteter Rom:nja aus der Ukraine wurde thematisiert. Keines der geflüchteten Roma-Kinder kennt das deutsche Schulsystem und viele von ihnen hatten auch in der Ukraine aufgrund von Ausgrenzung und antiziganistischen Strukturen keinen regelmäßigen Schulbesuch. Entsprechend fehlt ihnen beim Ankommen jede Orientierung darüber, wie Schule hier funktioniert und welche Erwartungen an sie gestellt werden. Gleichzeitig wurde von ihnen erwartet, sich rasch anzupassen. Der Workshop machte sichtbar, wie stark solche Erwartungen von einem mehrheitsgesellschaftlichen Verständnis von Normalität geprägt sind und wie schnell Kinder übersehen werden können, wenn Unsicherheiten im Umgang bestehen.
Sprache, Selbstbezeichnung und gesellschaftliche Verantwortung
Ein weiterer Diskussionspunkt war der Umgang mit Selbst- und Fremdbezeichnungen. Dabei wurde deutlich, dass einige Angehörige der Minderheit mit dem Begriff „Roma“ negative Erfahrungen verbinden und ihre Zugehörigkeit daher mitunter nicht offen benennen. Der Workshop betonte, wie wichtig es ist, Selbstbezeichnungen zu respektieren, niemanden zur Offenlegung zu drängen und Sprache bewusst so zu wählen, dass sie Menschen in ihrer Selbstbestimmung stärkt.
Was Fachkräfte für gelingende Zusammenarbeit brauchen
Zum Abschluss wurde herausgearbeitet, welche Voraussetzungen gelingende Zusammenarbeit fördern: Vertrauen, Selbstreflexion, Geduld, realistische Erwartungen, ein positives Menschenbild sowie der Rückhalt durch verlässliche fachliche Netzwerke. Der Workshop machte deutlich, dass professionelles Handeln ein Bewusstsein für historische Belastungen, gegenwärtige Benachteiligungen und individuelle Lebensrealitäten erfordert und dass Sensibilisierung ein fortlaufender Prozess ist.