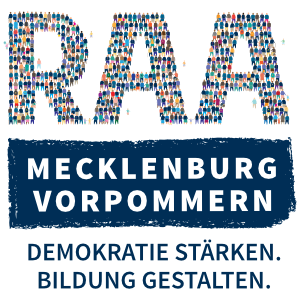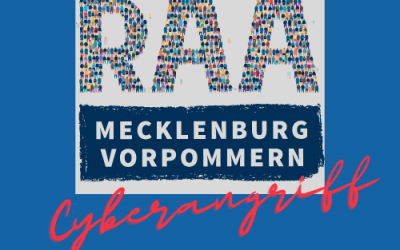Am 21. Oktober 2025 fand im Rahmen des Projekts RomDialog der RAA M-V e. V. die Online-Schulung „Sensibilisierung im Umgang mit vulnerablen Gruppen und Antiziganismus“ mit dem Bildungsberater Berry Paskowski statt. In einem intensiven Austausch mit fünf engagierten Teilnehmenden aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern ging es darum, wie Diskriminierung erkannt, reflektiert und im beruflichen Alltag abgebaut werden kann – und wie Fachkräfte Menschen aus besonders verletzlichen Gruppen sensibel und respektvoll unterstützen können.
Die kleine Gruppengröße ermöglichte einen offenen, persönlichen Austausch. Die Teilnehmenden brachten vielfältige Perspektiven ein – von der Arbeit mit geflüchteten Rom:nja aus der Ukraine über die Unterstützung von politischen Akteur:innen im ländlichen Raum und die Kinder- und Jugendförderung bis hin zu Schule und frühkindlicher Bildung. Dabei wurde deutlich, dass Sensibilisierung und Begegnung zentrale Voraussetzungen sind, um rassistische Vorurteile frühzeitig abzubauen.
Einblicke in das Bildungsberatungsprojekt
Berry Paskowski stellte das Bildungsberatungsprojekt des Verbands Deutscher Sinti und Roma Schleswig-Holstein vor. Das Projekt wurde in den 1990er Jahren von Angehörigen der Minderheit initiiert, um Chancengleichheit im Bildungswesen zu fördern und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Heute arbeiten in Schleswig-Holstein zwölf Bildungsberater:innen, die Schüler:innen, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen begleiten, Vertrauen stärken und über Rechte im Bildungssystem informieren. Das vom Bildungsministerium Schleswig-Holstein geförderte Projekt hat inzwischen bundesweit Modellcharakter und wurde auch in anderen Bundesländern aufgegriffen.
In seiner Arbeit verknüpft Berry pädagogische Unterstützung mit Vermittlungsarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Dabei geht es um gegenseitiges Verständnis, Transparenz und den Abbau von Vorurteilen und Ängsten – bei Minderheiten ebenso wie in der Mehrheitsgesellschaft.
Praxis und Herausforderungen
Anhand verschiedener Beispiele zeigte Berry, wie entscheidend Vertrauen, Geduld und Kontext im Umgang mit Diskriminierung sind. So berichtete er etwa von einem Schüler, der diskriminierende Begriffe aus dem Elternhaus übernommen hatte, durch persönliche Begegnungen aber seine Haltung reflektieren und verändern konnte.
Auch strukturelle Herausforderungen wurden thematisiert: Kinder aus Rom:nja-Familien werden noch immer überdurchschnittlich häufig zu sonderpädagogischen Überprüfungen geschickt – oft aufgrund antiziganistischer Vorannahmen. Diese Sonderbehandlungen lösen Ängste aus, die in vielen Familien historisch gewachsen sind. Hier braucht es Transparenz, Aufklärung und Sensibilisierung bei Lehrkräften.
Zentral ist es, Eltern und Kinder über ihre Rechte zu informieren und Selbstständigkeit zu fördern. Der Grundgedanke lautet: Hilfe zur Selbsthilfe, nicht neue Abhängigkeiten schaffen.
Sensibilisierung im Alltag
Rom:nja-Geflüchtete aus der Ukraine erleben häufig eine doppelte Diskriminierung: In der Hoffnung, in Deutschland als Ukrainer:innen wahrgenommen zu werden, sehen sie sich dennoch Vorurteilen gegenüber, die sich gezielt gegen Rom:nja richten. Viele erfahren, dass sie trotz gemeinsamer Fluchtgeschichte nicht gleichbehandelt werden. Fehlendes Wissen über das deutsche Bildungs- und Behördensystem erschwert die Orientierung zusätzlich. Hier braucht es verständliche Erklärungen, begleitende Unterstützung und Sensibilität auf beiden Seiten.
Berry betonte, dass Verständigung über persönliche Geschichten, Musik, Literatur oder Sport entstehen kann. Diese Zugänge ermöglichen es, über Ungerechtigkeit und Zugehörigkeit zu sprechen, ohne Menschen auf Herkunft oder Zuschreibungen zu reduzieren.
Was bleibt
Im gemeinsamen Gespräch wurde deutlich, was in der Bildungs- und Sozialarbeit zählt: Zeit, Geduld, Vertrauen, Selbstreflexion, Menschlichkeit und Kommunikation auf Augenhöhe. Nur so können Vorurteile abgebaut und Teilhabe ermöglicht werden.
Berry Paskowski betonte zum Abschluss, dass Schulungen wie diese Multiplikator:innen erreichen sollen – Menschen, die ihr Wissen weitergeben und dadurch Räume schaffen, in denen Vielfalt als Stärke verstanden wird.